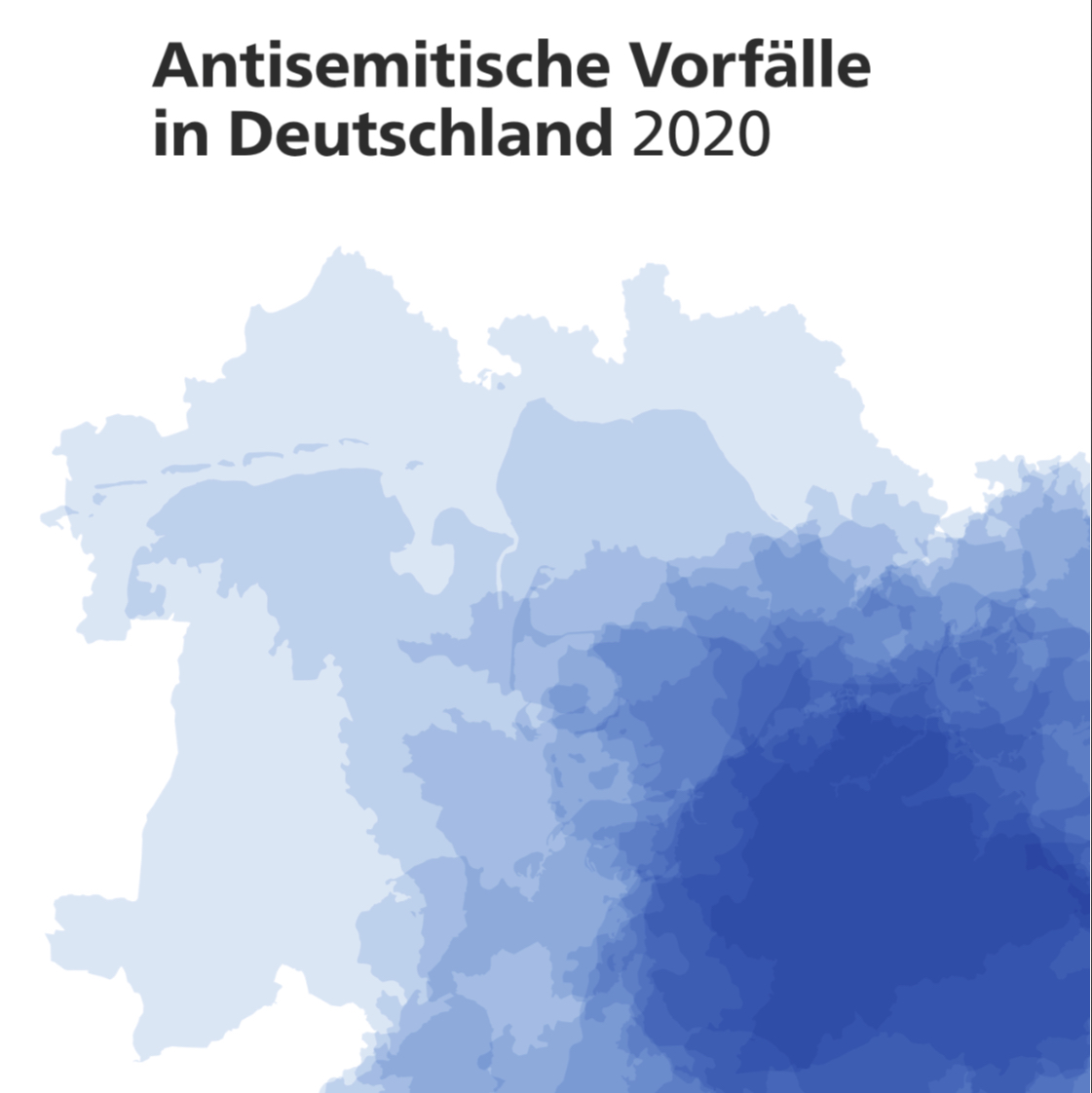RIAS legt Bericht vor
Insgesamt wurden von RIAS im Jahr 2020 genau 1.909 antisemitische Vorfälle in Deutschland dokumentiert. Das geht aus dem Bericht des Bundesverbands der Recherche- und Infor- mationsstellen Antisemitismus e.V. (RIAS) und der Meldestellen aus vier Bundesländern – Bayern, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein – hervor. Dabei handelte es sich um einen Fall extremer Gewalt, 39 Angriffe, 167 gezielte Sachbeschädigungen, 96 Bedrohungen, 1.449 Fälle verletzendes Verhalten sowie 157 antisemitische Massenzuschriften. Von den dokumentierten antisemitischen Vorfällen waren 677 Einzelpersonen und 679 Institutionen betroffen.
Aus dem Vorwort des Berichts: „Das Jahr 2020 war von der Coronapandemie und staatlichen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung (im Folgen- den kurz Coronamaßnahmen) geprägt. Ab Mitte März 2020 wurde das öffentliche Leben bundesweit zum Teil erheblich eingeschränkt. Während sich viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens ins Internet verlagerten, kam es seit April im gesamten Bundesgebiet zu zahlreichen Protesten gegen die Coronamaßnahmen. In diesem Zusammenhang kam es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Auch im Internet erfassten Meldestellen eine Vielzahl antisemitischer Vorfälle.
Antisemitismus manifestierte sich in Deutschland 2020 am häufigsten in der Erscheinungsform des Post-Schoa-Antisemitismus (zu Begriffserklärungen siehe Seite 9 des Berichts). Demonstrierende präsentierten verschiedene Varianten eines gelben Stoffsterns mit Aufdrucken wie „ungeimpft“, die auf die sogenannten Judensterne aus der Zeit des Nationalsozialismus anspielen. Mit dieser Selbstinszenierung als Opfer werden die Schoa und der Nationalsozialismus verharmlost. Auch die Rolle von Täter_innen und Opfern wird vertauscht – schließlich handelt es sich bei den meisten Demonstrierenden als Angehörige der deutschen Mehr- heitsgesellschaft um Kinder, Enkel_innen und Urenkel_innen von Täter_innen und Zuschauer_innen im Nationalsozialismus. Zudem wurde die Coronapandemie zur Projektionsfläche für antisemitische Verschwörungsmythen. Diese richteten sich gegen Jüdinnen_Juden als vermeintliche Urheber_innen oder Profiteur_innen der Pandemie.
Jüdinnen_Juden in Deutschland waren auch 2020 weiterhin mit dem rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 sowie mit dessen Aufarbeitung beschäftigt. Ab Juli stand der Täter vor Gericht, Ende Dezember wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheits- verwahrung verurteilt. Über 40 Nebenkläger_innen, darunter viele, die am Tag des Anschlags in der Synagoge hatten ausharren müssen, konnten den Prozess durch ihre Aussagen und Anträge maßgeblich mitgestalten. Der Prozess wurde so auch zu einer Plattform für jüdische und postmigrantische Perspektiven auf den Anschlag, auf aktuellen Antisemitismus in Deutschland sowie auf das fehlende Vertrauen von Jüdinnen_Juden in deutsche Sicherheitsbehörden. Das Verfahren löste Solidarisierungsprozesse zwischen von Rassismus und Antisemitismus betroffenen Communities aus, die auch außerhalb des Gerichtssaals Wirkung entfalteten, etwa bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Nebenkläger_innen und Angehörigen der Opfer des rechtsextremen Anschlags in Hanau im Februar 2020.
Aber auch unabhängig von der Coronapandemie und dem Anschlag in Halle prägte Antisemitismus 2020 den Alltag von Jüdinnen_Juden in Deutschland. Dies machen Befragungen innerhalb jüdischer Communities deutlich, die der Bundesverband RIAS (bzw. dessen Vorgängerprojekt) in mittlerweile acht Bundesländern durchgeführt hat. Die Interviews zeigen auch, dass viele Betroffene den Weg zur Polizei scheuen und viele antisemitische Vorfälle gar nicht strafbar sind. Um dieses Dunkelfeld zu er- hellen, Antisemitismus aus Sicht der Betroffenen zu dokumentieren und so für die nichtjüdische Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen, sind regional verankerte, niedrigschwellige und eng mit jüdischen Communities zusammenarbeitende Melde- und Unterstützungsnetzwerke nötig. In einigen Bundesländern existieren diese bereits, in anderen sind sie seit mehreren Jahren im Aufbau und in weiteren Ländern werden derzeit die Voraussetzungen hierfür geschaffen. Die Federführung übernimmt hierbei der im Oktober 2018 gegründete Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Seit Februar 2019 initiiert und unterstützt er den Aufbau regionaler Melde- und Unterstützungsnetzwerke in verschiedenen Bundesländern.“