Die Wuppertaler Wirtschaftswissenschaftlerin Vera Winter über Probleme im Gesundheitswesen
VON UWE BLASS
„Deutschlands Kliniken läuft das Personal davon“, titelte der Deutschlandfunk. Beim Arbeiten zwischen Überforderung und Resignation ziehen viele Mitarbeitende die Reißleine. Prof. Dr. Vera Winter, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Schumpeter School of Business and Economics an der Bergischen Universität, beschäftigt sich an ihrem Lehrstuhl für Management im Gesundheitswesen u.a. mit der Analyse der Arbeitssituation von Personal in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen und sagt: „Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Wir haben uns da in einen Teufelskreis hineinbewegt.“

Das Problem entwickele sich bereits seit 2003, als mit der rot-grünen Regierung unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die sogenannten Fallpauschalen eingeführt wurden. Krankenhäuser begannen Personalkosten zu reduzieren; dadurch stand weniger Personal zur Verfügung und die verbliebenen Pflegefachkräfte wurden häufig überlastet, fielen durch Krankmeldungen öfter aus oder wechselten sogar den Beruf. Zwar habe die Politik nach ein paar Jahren das Dilemma erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen, konnte aber bisher diesen Teufelskreis nicht durchbrechen. Mit der reinen Anzahl der Pflegefachkräfte sei Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt, erklärt Winter, „aber wir haben das historisch gewachsene Problem, dass wir zu viele Einrichtungen haben, auf die das Pflegepersonal verteilt ist. Die Überversorgung, die wir in der Krankenhauslandschaft sehen, führt auch dazu, dass zu viele Häuser zu versorgen sind.“ Mittlerweile gebe es ein Umdenken in den Kliniken, neue Arbeitszeitmodelle sowie ein Aufbrechen der hierarchischen Strukturen, aber das sei sehr schwer umzusetzen. „Es gibt Ansätze in die richtige Richtung, doch es muss jetzt auch schnell etwas passieren!“
Fallpauschalensystem – eine aus wirtschaftlicher Sicht gute Idee
Das DRG-Fallpauschalensystem (DRG steht für „Diagnosis Related Groups“, ein Klassifikationssystem für ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren, Anm. d. Red.) kann man vereinfacht so erklären: Für Patient X mit Diagnose Y bekommt ein Krankenhaus Betrag Z von der Krankenkasse bezahlt, egal wie lange die Person in der Klinik bleibt. Heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß, scheinen an dieser Stelle einem professionellen Management die Hände gebunden zu sein. „Krankenhausfinanzierung ist ein komplexes Thema“, beginnt die Fachfrau, „die DRGs wurden damals eingeführt, weil die Kosten immer weiter gestiegen sind, weil die Krankenhäuser alles machen und damit auch unwirtschaftlich sein konnten. Alle Kosten wurden ihnen mehr oder weniger erstattet, was bedeutet, es gab gar keine Anreize, wirtschaftlich zu sein. Wirtschaftlich heißt nicht immer an Qualität sparen, sondern bedeutet auch z. B. Doppeluntersuchungen zu vermeiden oder bei Indikationen, wo es nicht notwendig ist zu operieren, es auch einfach nicht zu tun. Das war der Grund für die Einführung dieses Systems, und diese Idee ist meiner Meinung nach auch gut!“ Doch es habe sich in der Entwicklung gezeigt, dass das System auch Fehlanreize geschaffen habe und zum Beispiel zu einer Fallzahlsteigerung angeregt habe. Zudem sei die allgemeinstationäre Versorgung deutlich attraktiver als ambulante OPs an Krankenhäusern, weil letztere weitestgehend deutlich geringer vergütet werden. „Diese Fehlanreize, die durch das DRG-System kamen, die haben irgendwann überhandgenommen. Die Fallzahlen sind immer weiter gestiegen, das kann nicht allein durch Veränderungen in der Krankheitslast in der Bevölkerung erklärt werden. Und die Ausgaben für Krankenhäuser wurden somit auch nicht gebremst“, erklärt Winter. Die Wissenschaft denkt natürlich über Alternativen nach, doch welche Kosten sind gerechtfertigt? Und wie kann man das am ehesten steuern? Dazu Winter: „Das ist eine riesige Debatte, ohne eine optimale Lösung. Gerade jetzt wird wieder etwas substantiell Neues auf den Weg gebracht und es wird spannend zu sehen, ob das die gewünschten Ziele erreicht oder ob wir wieder neue Fehlanreize kreieren.“
Versorgung ist komplex und schwierig
Aus Berlin kam vor kurzem die Meldung: 80 Prozent der Mediziner der Charité in Berlin vergibt der Versorgungsqualität des Krankenhauses die Schulnote vier oder schlechter. „Versorgung ist unglaublich komplex und schwierig“, erklärt die Wissenschaftlerin. Große Häuser mit einem vielseitigen Behandlungsangebot hätten oft Schwierigkeiten, die Qualität in allen Bereichen sicher zu stellen. Darüber hinaus betreffe der Fachkräftemangel nicht nur die Pflegefachkräfte, sondern auch die Ärzteschaft. „Universitätskliniker sind noch zusätzlich betroffen von überdurchschnittlichen Kosten im DRG-System, denn sie haben in ihrem Bereich nicht die ganzen leichten Fälle, sondern eher die schwereren Fälle und kommen dadurch nie mit den Kosten hin. Das andere ist, man weiß auch immer, was potentiell noch möglich wäre, aber im System nicht machbar ist.“

Digitalisierung im Gesundheitswesen – ein deutsches Problem?
Der Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen wird nicht als Entlastung gesehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellte sogar fest: „Wir sind, was die Digitalisierung angeht, im europäischen Vergleich Entwicklungsland.“ Hat Deutschland da Jahre geschlafen? „Da könnten wir die gleiche Frage auch an die Universitäten richten“, lacht die Wissenschaftlerin. „Ich habe ein paar Jahre in Dänemark gearbeitet und da ist der Stand an Krankenhäusern und Universitäten ein komplett anderer. Die Digitalisierung ist allgemein ein deutsches Problem. In den Krankenhäusern kommt erschwerend hinzu, dadurch, dass in den Betriebskosten immer nur das finanziert wird, was quasi der Durchschnittspreis ist, hat man Schwierigkeiten, neue digitale Lösungen umzusetzen, denn wo nimmt man das Geld her?“ Offiziell sollten zwar Investitionen über die Länder aufgewendet werden, jedoch sei da auch ein riesiger Investitionsstau zu berücksichtigen. „Für kleine Häuser ist es sehr schwierig, da etwas zu implementieren. Und wenn, dann läuft es häufig auch noch parallel zu den alten Prozessen. Wir haben sehr viele verschiedene digitale Lösungen, die nicht miteinander gekoppelt sind, so dass es dann doppelter Aufwand ist.“

Falldokumentation – Fluch und Segen zugleich
Pflegekräfte dokumentieren im Durchschnitt etwa pro Tag drei Stunden. Bei Ärztinnen und Ärzten ist es ein Drittel der Kollegen, die sogar mehr als vier Stunden dokumentieren. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat einmal ausgerechnet: Wenn wir die drei Stunden Pflegedokumentation nur um eine Stunde reduzieren würden, dann würde die Arbeitszeit von 60.000 Vollzeitpflegekräften freigesetzt. „Das ist ein unglaublich schwieriges Feld“, sagt Winter, „weil wir die Daten ja auch brauchen.“ Wenn man z. B. die Medikamentengabe eines Patienten nicht dokumentiere (am besten digital dokumentieren), könne man nicht sicherstellen, dass die Pflegekraft der nächsten Schicht noch einmal die gleiche Dosis verabreiche. „Nur so können wir sicherstellen, dass auch Forschende Zugang zu diesen Daten bekommen und schauen können, ob bspw. die Medikamentengabe leitlinienkonform ist, oder Kombinationen von Medikamenten, die nicht zusammen verabreicht werden dürfen, berücksichtigt werden.“
Ebenso würden heute zum Beispiel die Pflegepersonaluntergrenzen dokumentiert, die zeigen sollen, dass pro Pflegekraft nur die maximal zulässige Anzahl Patienten betreut werden, um auch wirklich die Qualität der Versorgung zu gewährleisten. Mittlerweile gebe es allerdings eine so große Anzahl von Qualitätssicherungsmaßnahmen, die in den Häusern auch als eine überbordende Kontrollbürokratie empfunden wird. Daher stellt sich für Winter die Frage: „Wie kommen wir also dahin, den Krankenhäusern zu vertrauen, dass sie das auch intrinsisch hinkriegen.“
Die deutsche Sprache ist eine große Hürde für ausländisches Fachpflegepersonal
Die tatsächliche Sprachkompetenz von ausländischen Pflegefachpersonen weise in Deutschland eine große Varianz auf, sagt die Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e. V. (GQMG). Nach Eintreffen in Deutschland werden die zugewanderten Pflegefachpersonen in den pflegerischen Einrichtungen wegen des Fachkräftemangels meist unmittelbar mit den komplexen Aufgaben der deutschen Fachpflege konfrontiert. In der Analyse bzgl. der Integration von Pflegekräften mit Migrationshintergrund bestätigt Winter, dass die Sprache eine der größten Hürden sei, wobei manche Häuser dies auch erkannt hätten. „Integration gelingt nur, wenn wir da wirklich und zwar richtig investieren. Es müssen vorab Sprachkurse finanziert werden und Integrationsmanager für die Pflegekräfte da sein, die das dann begleiten. Die Häuser, die das machen können, die sind tendenziell mit der Integration flexibler.“ Im Gegensatz dazu würden weniger solvente Häuser, die sich diesen Service nicht leisten könnten, aber ebenfalls im Zuge des Fachkräftemangels auf ausländische Mitarbeitende angewiesen seien, die Sprachbarriere im Zweifel eher tolerieren, anstatt Patienten nicht versorgen zu können. „Es ist eine sehr schwierige Abwägung“, sagt Winter, „einerseits geht es vielerorts nicht mehr ohne aus dem Ausland rekrutierte Pflegekräfte. Andererseits sind auch die gebürtigen Pflegekräfte frustriert, wenn sie sich nicht verständigen können oder die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Das macht den Pflegeberuf dann noch unattraktiver.“
Die Rolle der Pflegekräfte in anderen Ländern
Fast ein Viertel aller Erwerbstätigen im Gesundheitswesen hat einen Migrationshintergrund. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Polen, die Türkei, Russland und Kasachstan. Ärztinnen und Ärzte stammen überdurchschnittlich häufig aus Osteuropa und dem Nahen und Mittleren Osten. Über Pflegeagenturen kommt immer mehr examiniertes Pflegepersonal mit Anerkennung, die aber nicht alles machen dürfen, was examinierte Fachkräfte dürfen. „Wir können das Potential des Pflegepersonals nicht vollumfänglich ausschöpfen“, sagt Winter, „das ist sowohl für die, die mehr machen müssen, problematisch, als auch natürlich für die Pflegekräfte selber, die auf einmal nicht mehr ihre vertraute Arbeit leisten dürfen und frustriert werden, weil sie fachlich unterfordert sind.“ Da müssten von staatlicher Seite die Anerkennungsverfahren besser geregelt werden, fordert die Fachfrau. Ebenso müsse man sich mit dem Aufgabenbereich der Pflegekräfte im Herkunftsland auseinandersetzen, da manche Tätigkeiten dort nicht zum Pflegestandard gehörten. „In Deutschland ist das Pflegepersonal auch für die Patientenversorgung und Lagerung zuständig, sie helfen häufig bei Toilettengängen und reichen das Essen an, während das in anderen Ländern die Familienangehörigen machen. Da muss auch noch eine Adaption stattfinden, die den ausländischen Pflegefachkräften den deutschen Standard vermitteln.“
Turbulente Geschäftsführungswechsel
In einem Krankenhaus in Wuppertal hat es in wenigen Jahren fünf Geschäftsführerwechsel gegeben, die immer neue Ideen eingebracht haben, ohne mit der Basis, also den Pflegekräften, zu sprechen. U.a. wurden die Apotheke outgesourct und das Essen kommt nun aus ca. 50 km Entfernung zum Krankenhaus. Spontane Änderungen in der Medikation oder in der Essensbestellung sind unmöglich geworden. „Wir forschen ja zu Geschäftsführungswechseln, die in Krankenhäusern deutlich häufiger sind, als in anderen Industrien. Da sehen wir auch, dass das eine sehr turbulente Branche ist, und dass natürlich Geschäftsführungswechsel viel Veränderung produzieren“, erklärt Winter. Jeder BWL-Studierende wisse, dass Entscheidungsprozesse nie nur top/down, sondern auch immer bottom/up laufen sollten, manche Entscheidungen seien dabei aber auch undemokratisch zu treffen. „Wenn ich bei der Essenslieferung sagen wir mal 50% der Kosten sparen kann, indem ich das outsource, und dafür die eingesparten 50% nicht woanders sparen muss, dann kann das wirtschaftlich sehr sinnvoll sein. Aber auch das muss kommuniziert werden, so dass alle Mitarbeitenden es verstehen. Wir haben im Krankenhaus eigentlich drei Sprachen. Wir haben diese medizinisch-pflegerische Sprache, die medizinische Sprache und die betriebswirtschaftliche Sprache. Das sind auch andere Denkweisen, und daran scheitert auch oft viel.“
Work-Life-Balance statt Aufopferungsbereitschaft
Work-Life-Balance spielt bei jungen Mitarbeitenden eine immer größer werdende Rolle. Viele wollen gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Die Erwartungshaltung bei jungen Arbeitnehmenden ist sehr hoch, ältere Mitarbeitende haben oft keine Lust mehr auf Generation XYZ. Die Einstellung zum Beruf hat sich verändert und Serviceangebote wie z. B. die Eltern-Dienste, bei denen Pflegekräfte ihre Kinder zuerst in die Kita bringen dürfen, bevor sie ihre Arbeit antreten, führen dazu, dass die anderen Mitarbeitenden die Grundpflege am Morgen für die fehlenden Kolleg:innen noch zusätzlich leisten müssen. Das stellt Krankenhäuser vor große Probleme. „Ja“, sagt die Wissenschaftlerin, „man hört viel Schimpfe über die neue Generation, und ich kann das auch nachvollziehen.
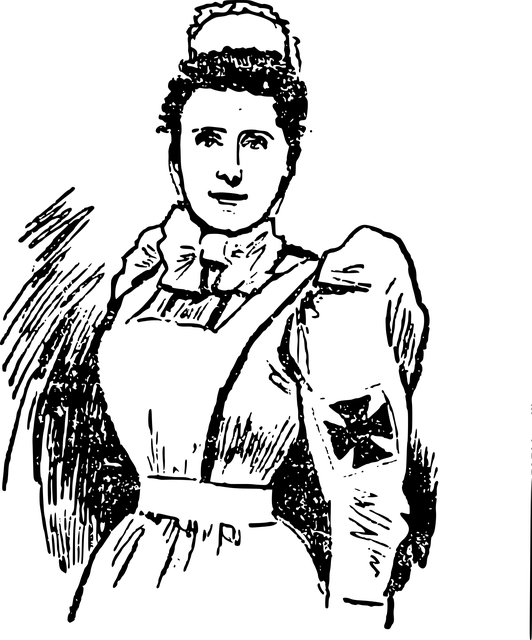
Aber auf der anderen Seite kann man fragen, ob dieses ´Aufopfern`, was man von den älteren Generationen erwartet hat, wirklich das Gesunde ist? Oder ist das, was die neuen Mitarbeitenden machen, nicht viel gesünder? Im Moment erleben wir diesen Generationswechsel und der geht zu Lasten der Aufopferungsbereiten. Aber wenn man die dann nicht mehr hat, sondern nur noch die Mitarbeitenden, um die man sich dann wirklich kümmern muss, weil sonst keiner mehr da ist, schaffen wir es vielleicht, zu einer gesünderen Arbeitswelt zu kommen. Elternfreundliche Arbeitszeiten sollten eigentlich selbstverständlich sein, denn Kinder müssen in unserer Gesellschaft mitgedacht werden. Wenn wir wollen, dass Frauen und Eltern allgemein arbeiten, müssen wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf praktizieren. Da ist Dänemark um einiges weiter, auch im Krankenhauswesen.“
Prof. Dr. Vera Winter ist seit 2019 Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Management im Gesundheitswesen, an der Bergischen Universität Wuppertal. Vorab war sie an den Universitäten Süddänemark, Hamburg und Mannheim tätig und absolvierte einen Gastaufenthalt an der Harvard University.
Beitragsfoto © UniService Transfer


