Der Historiker Georg Eckert über die Geschichte der Demokratie
VON UWE BLASS
Die Demokratie liegt im Sterben, unkt die industrialisierte Welt, weil das System nicht gehalten hat, was es versprach. Gleichzeitig bringen Sie, zusammen mit Dr. Thorsten Beigel, in dieser Situation ein Buch heraus, in dem Sie die Geschichte der Demokratie von der Antike bis in unsere Zeit schildern. Gibt es also doch noch Hoffnung, den Patienten zu retten?
Eckert: Die Demokratie lebt. Das sehen wir schon an einer lebhaften und kontroversen Deutung ihres Zustandes in Medien aller Art – und daran, dass man hierzulande zum Beispiel auch ungestraft Sympathien für den russischen Präsidenten bekunden darf. Andersherum ist das ja eher schwierig. Eigentlich sind manche Krisen-Diskurse sogar der beste Beweis dafür, wie quicklebendig das Ideal der Volksherrschaft bei uns ist. Solange man um ihre Ausgestaltung streitet, hat man sie noch nicht aufgegeben. Und die Demokratie lebt auch, ja gerade angesichts großer nationaler wie internationaler Herausforderungen von einem gewissen Optimismus: nämlich dem Vertrauen darauf, dass ein freier Austausch von Ideen die größte Wahrscheinlichkeit hat, gute, dauerhafte und vor allem akzeptanzfähige Lösungen für unterschiedlichste Probleme zu finden. Gleichwohl macht uns Sorgen, dass vielerorts bei vielen die Bereitschaft wächst, die Zukunft des Landes vermeintlichen autoritären Wunderheilern anzuvertrauen. Die Aufgabe muss allenthalben sein, dem mit guter, nämlich gut gemachter und gut begründeter Politik zu begegnen.
In Ihrem Buch stellen Sie in Kapitel 2 die Frage: „Kann die breite Masse eigentlich zu ihrem eigenen Besten entscheiden, ja kennt sie überhaupt ihre Interessen?“ Ist vielleicht die Teilhabe aller an der politischen Willensbildung ein Problem von Demokratie?
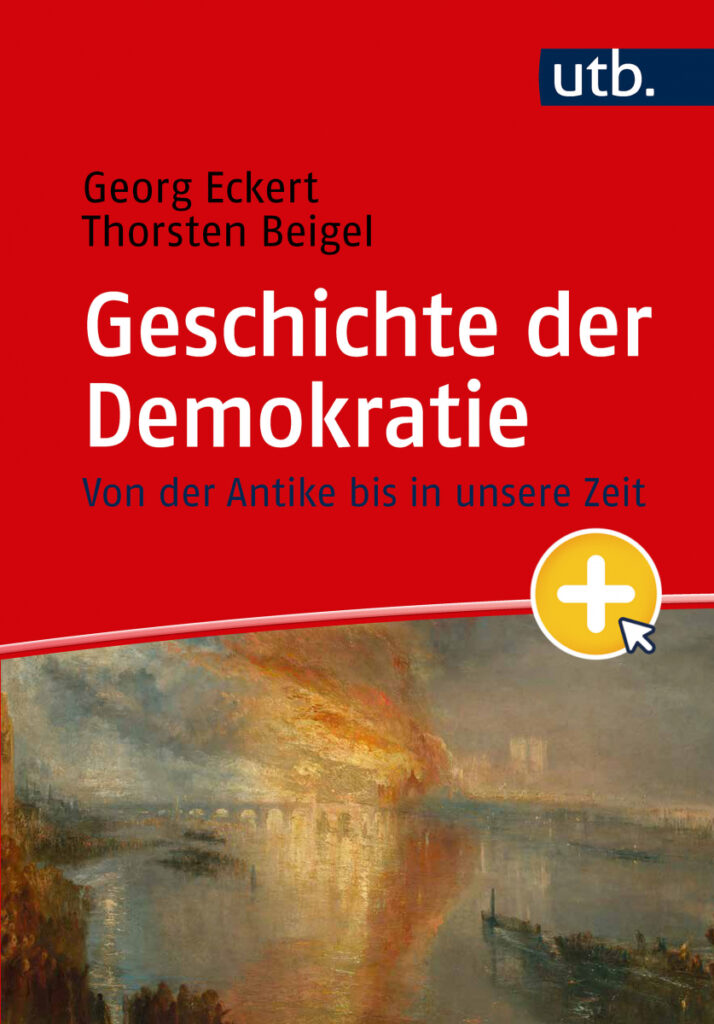
Eckert: Sie ist zunächst einmal die exklusiv demokratische Lösung für viele Probleme. Denn politische Mitwirkung des Volkes trägt eine große Gewähr dafür in sich, dass Beschlüsse von einer Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen statt boykottiert werden – und dafür, dass Regierende auf das Rücksicht nehmen, was diejenigen zu bewegen scheint, denen sie ihre Macht verdanken. Aber die Teilhabe aller, die ja etwa angesichts sehr ungleicher Wahlbeteiligungsraten in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen teils eher ein Postulat als eine Realität beschreibt, bleibt zugleich eine Herausforderung – und sie ist auch der jahrtausendealte Standard-Einwand gegen das Prinzip der Demokratie: nämlich als Kritik an der launischen Herrschaft von Ungebildeten, die man schon im antiken Athen finden kann. Aber in gewisser Weise war die Sorge vor einem emotionsgeleiteten „Mob“ paradoxerweise auch selbst ein wichtiger Demokratisierungsfaktor, mit ihr die Vorstellung, radikale Ideen durch Parlamente und Parteien mäßigen zu können: Die epochalen Erweiterungen des Wahlrechts im 19. und 20. Jahrhundert geschahen nicht zuletzt mit Rücksicht darauf, dass die Bevölkerung ansonsten womöglich zur Revolution schreite. Vom Volk als Souverän waren nämlich die wenigsten begeistert, die meisten hielten es für notorisch unvernünftig. Das bis heute immer wieder berühmte Bonmot „Jede Nation bekommt die Regierung, die es verdient“ stammt von einem Mann des Ancien Régime, vom französischen Staatsmann und Staatsdenker Joseph de Maistre.
Sie stellen in Ihrem Buch verschiedene Formen der Demokratie im Laufe der Geschichte vor. Welche war denn am überzeugendsten?
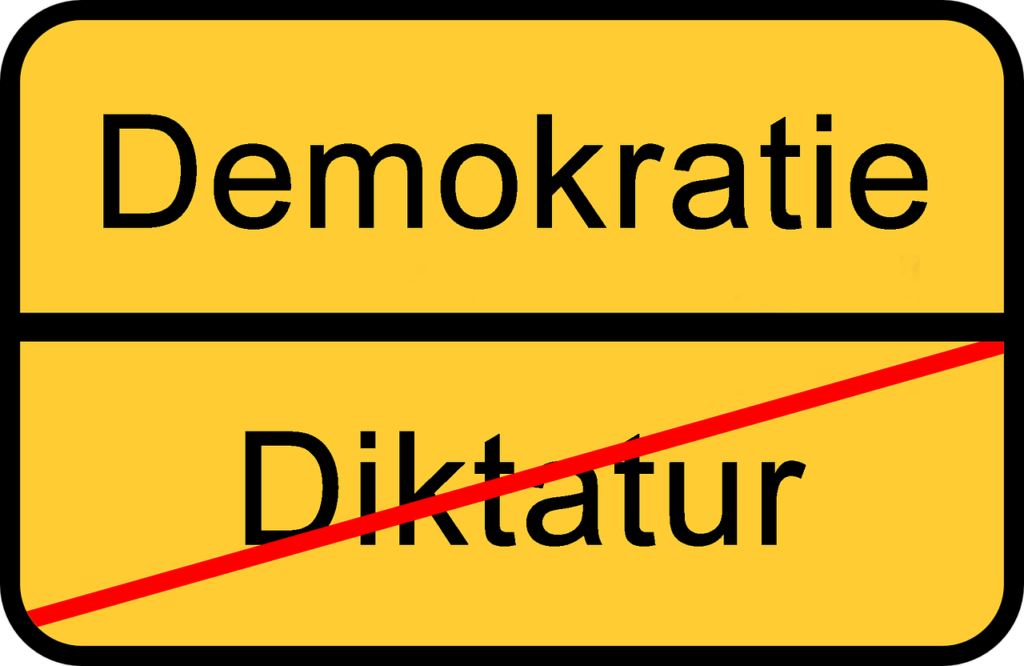
Eckert: Die größte Überzeugungskraft haben demokratische Systeme, die gut zu den jeweiligen Gegebenheiten passen, weil sie den Mitwirkenden das Gefühl geben, in einem vertrauten Regierungssystem zu leben und Politik wirklich mitgestalten zu können. Die kleinräumige direkte Demokratie der Schweiz ließe sich in einem großen Staat wie den Vereinigten Staaten kaum denken. Eine weitere Erfahrungsregel lässt sich ebenfalls herleiten: Demokratien, die nicht den Wohlstand jedenfalls eines einflussreichen Teils der Bevölkerung zu sichern vermögen, geraten rasch unter Legitimationsdruck – so etwa die Weimarer Republik, die freilich die Probleme, an denen sie zugrunde ging, unmöglich selbst hätte lösen können. Das Weimarer Beispiel gibt auch einen weiteren Hinweis. Stabile Demokratien müssen wehrhaft sein dürfen, sie haben sich von ihren Feinden vieles, aber eben nicht alles gefallen zu lassen. Stabile Demokratien erkennt man zudem an einem Lackmustest, nämlich der Frage, ob Machtwechsel friedlich erfolgen. Das tun sie dort, wo die Unterlegenen weiterhin Grund zur Hoffnung haben, nicht bedrängt zu werden und nach einer weiteren Wahl wieder an die Macht zu gelangen.
In einem Kapitel widmen Sie sich auch der amerikanischen Demokratie. Wir erleben gerade die laufenden Präsidentschaftswahlen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Unter den Bedingungen von Massenmedien gleicht das „demokratische“ Ringen um das höchste Amt im Staat eher einer Schlammschlacht zweier Parteien, die sich nur noch als Feinde betrachten. Wie kann da denn wieder Vertrauen aufgebaut werden?


Eckert: Die Logiken von Massenmedien gelten auch in anderen Regierungssystemen: Da kommt es ebenfalls zu Schlammschlachten – nur mit ungleich brutaleren Folgen, wenn Regimegegner in Arbeitslager geschickt werden. Vor allem gehört zu den Vorzügen der Demokratie, dass Konflikte offen ausgetragen werden können; an einem Diktator kann man kaum scharfe Kritik üben, jedenfalls nicht lange. Ein gewisses Maß an gegenseitigen Vorwürfen und Beschimpfungen gehört zum Geschäft: besser Schlammschlachten als Straßenschlachten.
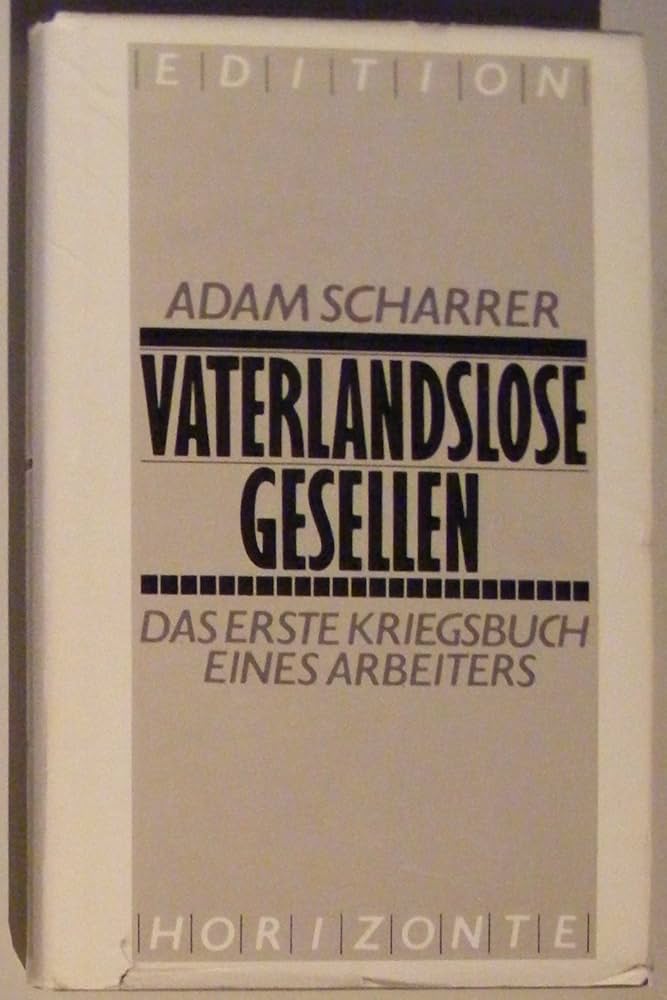
Erstere haben einen gewissen Unterhaltungswert; erst im Übermaß wird es problematisch. Wenn Sozialdemokraten im wilhelminischen Deutschland als „vaterlandslose Gesellen“ angegriffen wurden, wurde allerdings Feindschaft betrieben, und Gerhard Schröders Spott über den „Professor aus Heidelberg“ war auch kaum freundlich gemeint. Prinzipiell kennt aber gerade die angloamerikanische Tradition doch sehr robuste Wahlkämpfe, im 19. Jahrhundert ging es teils wesentlich härter zur Sache (oder vielmehr: zur Person) als heutzutage. Ohnehin sind die politischen Systeme in Großbritannien und den Vereinigten Staaten wesentlich konfliktgeprägter als unser deutsches, das eher konsensual gestimmt ist. Entscheidend ist aber weniger das, was im Wahlkampf passiert, sondern das, was nach der Wahl geschieht, nämlich die Frage, ob der Wahlverlierer und dessen Anhänger eine Niederlage anerkennen – und ob sie bei gegenläufigen Mehrheiten zu Kompromissen finden. Der Sturm auf das Weiße Haus nach der letzten Präsidentschaftswahl war ein Stresstest der Demokratie, aber sie hat ihn zunächst einmal offenkundig bestanden. Daraus kann man ein gewisses Vertrauen schöpfen – ebenso daraus, wenn siegreiche Parteien nach der Wahl ihre Versprechungen einlösen, statt leere Ankündigungen und Streit untereinander zu betreiben.
Noch mehr als andere Regierungsformen beruht die Demokratie jedoch auf der Erfahrung, dass dieses Regierungssystem der Bevölkerung ein möglichst gutes und selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Wir haben es alle in der Hand, Vertrauen zu schaffen: Berufspolitiker und Wähler gleichermaßen. Verordnen lässt sich das nicht, vielmehr entscheiden wir alle jeden Tag aufs Neue, wie wir über Politiker und Politik reden.

Reichstag in Berlin © gemeinfrei
Gleich vier Kapitel widmen Sie der Demokratie im 20. Jahrhundert, die ja auch diverse Höhen und Tiefen durchlebt hat. Was davon würden Sie als besonders prägend für uns heute sehen?
Eckert: Gerade die deutsche Geschichte zeigt – wohl die wichtigste Lektion – die Brüchigkeit von Demokratien auf. Demokratie ist keine Zwangsläufigkeit der Weltgeschichte. Herrschaft des Volkes kann auch wieder vergehen, es gilt also schon, etwas dafür zu tun, damit sie bleibt. Demokratie muss wachsen, man kann sie nicht mit der Verkündung einer Verfassung schaffen – das ist die zweite Lektion: Der problemlose Machtwechsel im Jahre 1969 war mit Blick auf die deutsche Demokratiegeschichte vielleicht wichtiger als die Verkündung des Grundgesetzes zwanzig Jahre zuvor.
Der Westen wiederum erlebte nach dem Ende des Kalten Krieges eine kurze Euphorie der Demokratie, die aber etwa im Irak und in Afghanistan rasch der Erkenntnis gewichen ist, dass auch die Demokratie von Bedingungen lebt, die sie selbst nicht gewährleisten kann (so könnte man in Abwandlung eines berühmten Diktums des Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde formulieren). Ob eine Demokratie entsteht und besteht, hängt eben von vielen Umständen ab; zur Demokratie gehört auch eine spezifische politische Kultur, die sich entwickeln muss.
Die dritte Lektion könnte folgende sein: Der vielleicht größte Vorzug der Demokratie besteht darin, dass sie das einzige Regierungssystem darstellt, in dem eben dieses freimütig kritisiert und per Wahl rasch verändert werden kann. Der regelmäßige Machtwechsel kann Reformen zwar auch ausbremsen, aber sorgt für eine häufigere Erneuerung des Personals als in anderen Herrschaftsformen – und die Demokratie hat das größte Personalreservoir, indem jeder wählen und gewählt werden kann.
Die Demokratie auf der ganzen Welt steht unter Druck. Verantwortlich für den weltweiten Aufwind rechter Parteien ist auch die Politik der etablierten Kräfte. Können Sie das einmal erklären?
Eckert: Viele der westlichen Demokratien tun sich seit geraumer Zeit schwer, große Themen anzupacken – und stehen vor dem Problem, dass bewährte Modelle in unserem Zeitalter nicht mehr funktionieren wie ehedem. Und so wohlfeil generelle Kritik ist: Parteien tun sich schwer, Personal jenseits eingefahrener Muster zu rekrutieren. Per se ist das allerdings nicht beunruhigend. Denn es stellt geradezu ein Lebenselixier vom Demokratie dar, dass sich immer wieder neue Parteien gegen die etablierten bilden; für politische Vereinigungen gibt es keine Ewigkeitsgarantie. Sie sind an konkrete Interessen und Weltanschauungen gebunden, so etwas verändert sich. Hierzulande waren die Grünen ja auch einmal eine Partei, die sich dezidiert gegen das „Establishment“ gegründet hat, heute sind sie geradezu dessen Inbegriff. Wenn sich neue Parteien formieren, ist das meist mit gesellschaftlichem Wandel verbunden. Den kann man kaum aufhalten, aber es gibt Parteien auf der Linken wie auf der Rechten, die so tun, als ob: Populisten unterschiedlicher Couleur, die davon profitieren, dass in den letzten Jahrzehnten ein rapider sozioökonomischer Wandel eingesetzt hat. Er schafft Chancen für manche, aber andere nehmen ihn mit – keineswegs unberechtigten – Verlustängsten wahr, die entsprechende Parteien zu bedienen wissen. In einer immer unsicherer scheinenden Welt ist es eine folgerichtige Reaktion, wenn sich Menschen auf das beziehen, was sie gut kennen oder gut zu kennen glauben: Und das ist nicht zuletzt die eigene Nation, die in einer entgrenzten Welt mit großen Migrationsströmen wenigstens etwas Geborgenheit und Sicherheit verspricht. Das muß man ernst nehmen, wie auch immer man dazu stehen mag.
Am 22. September steht die Landtagswahl in Brandenburg an. Es ist mit einem hohen Ergebnis der AfD zu rechnen. Warum erreichen die etablierten Parteien die Wähler:innen nicht mehr?
Eckert: Die Gründe für eine Erosion der Wählerbasis sind vielschichtig, sie liegen in den Parteien selbst, im politischen System, im gesellschaftlichen Wandel – und auch im medialen. In Sozialen Medien haben viele etablierte Parteien offenkundig sowohl Nachholbedarf als auch strukturelle Nachholprobleme. Twitter & Co. sind eher keine Foren, die abwägende Darstellungen begünstigen. Aber das Problem liegt tiefer, denn zumal die klassischen tagespolitischen Verlautbarungen quer durch sämtliche Massenmedien empfinden viele Menschen immer mehr als inhaltsleeren „Politsprech“ – und das kann man durchaus verstehen. Vielleicht holt etablierte Parteien auch ein, dass sie bisweilen höhere Erwartungen an ihre Akteure und auch an das politische System geschürt haben, als klug war. Keine Demokratie kann allen Menschen zugleich das Leben verschaffen, das sie gerne hätten, jedenfalls keine zukunftsfähige. Es ist auch eine wichtige Vermittlungsaufgabe, öffentlich damit umzugehen, dass die gewohnten Wachstumsraten und ein über Generationen zunehmender Wohlstand keine Selbstläufer sind: Die Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Roman Herzog haben schon vor gut dreißig Jahren appelliert, dass etwas mehr Bewegung ins politische System kommen müsse. Das liest sich durchaus noch aktuell.
Welche Quintessenz ziehen Sie aus der Geschichte der Demokratie, die es wert ist, diese Herrschaftsform weiter zu unterstützen?
Eckert: Blickt man auf die Geschichte Demokratie seit dem antiken Athen, auf das Werden und Vergehen von unterschiedlichen Spielarten der Volksherrschaft, gelangt man zu einem nüchternen Optimismus. Winston Churchill, der zwei Jahre zuvor (wohlgemerkt als frischgebackener Weltkriegssieger) nach einer verlorenen Parlamentswahl seinen Posten als Premierminister hatte räumen müssen, hat es im Jahre 1947 in einer Unterhausdebatte auf eine nach wie vor aktuelle Pointe gebracht: „Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time“ („In der Tat wurde gesagt, dass Demokratie die schlechteste Regierungsform ist, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden“).

Wir wären schlecht beraten, uns von der Demokratie fortgesetzte Wunder zu erwarten. Volksherrschaft ist keine Wohlstandsgarantie, auch in demokratischen Staaten muss um knappe kollektive Ressourcen und deren Zuteilung gestritten werden. Aber solche Gemeinwesen bieten die größten Chancen, dass das auf möglichst zivile Weise und mit möglichst geringer Diskriminierung derjenigen geschieht, die gerade nicht in der Mehrheit sind. Das dürfte ein ganz zentraler, zugleich ein sehr ermutigender Befund aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Demokratie sein. Optimismus stiftet zudem die Beobachtung, dass Demokratie ganz unterschiedliche Formen annehmen und sich oftmals neuen Gegebenheiten gerade deshalb so gut anpassen kann, weil sie viele Wahrnehmungen und Interessen zu integrieren vermag. Welche die vielversprechendste Form der Volksherrschaft ist, entscheiden meist Umstände, die man in der Regel nicht von heute auf morgen ändern kann.
Georg Eckert, Thorsten Beigel: Geschichte der Demokratie. Von der Antike bis in unsere Zeit. Vandenhoeck & Ruprecht 2023; 30,00 Euro.
Dr. Georg Eckert studierte Geschichte und Philosophie in Tübingen, wo er mit einer Studie über die Frühaufklärung um 1700 mit britischem Schwerpunkt promoviert wurde, und habilitierte sich in Wuppertal. 2009 begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Geschichte und lehrt heute als Privatdozent in der Neueren Geschichte.

