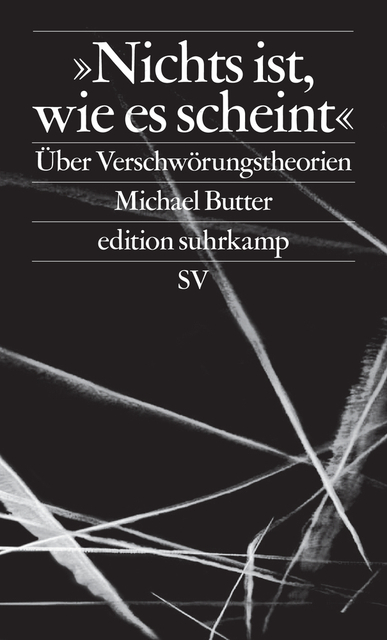… ähnliche Äußerungen wie diese sind auch in Zeiten der gegenwärtigen Corona-Pandemie – vor allem im Internet – zu vernehmen. Artikuliert werden in diesem Sinne Mutmaßungen über die Verursacher*innen der Pandemie, ihre Pläne und ihre Ziele, in denen sich allzu oft auch antisemitische und rassistische Vorstellungen widerspiegeln. Die Verbreitung derartiger Verschwörungstheorien verweist auf die enorme Aktualität des Buches ‚‚Nichts ist, wie es scheint‘. Über Ver- schwörungstheorien‘ von Michael Butter, die dieses auch längerfristig noch haben wird.
In ihm widmet sich der Autor in einer sehr leserfreundlichen und klaren Sprache sowie in differenzierter Weise dem Thema ‚Verschwörungstheorien‘, die er bewusst als -theorien und nicht etwa als -ideologien bezeichnet und von ‚Verschwörungsgerüchten‘ abgrenzt. Seine Analysen entfaltet er unter Einbezug konkreter verschwörungstheoretischer Texte sowie von Fallstudien und macht nachvollziehbar deutlich, was solche Theorien charakterisiert und wieso sie seit Jahrhunderten für so viele Menschen attraktiv sind.
Dabei geht er auch auf Unterschiede zwischen überaus realen Verschwörungen und Verschwörungstheorien ein. Für Letztere stelle die „Idee, dass Geschichte plan- und kontrollierbar ist“, etwas Wesentliches dar, so Butter. „Verschwörungstheorien basieren auf der Annahme, dass Menschen den Verlauf der Geschichte ihren Intentionen entsprechend lenken können, dass Geschichte also planbar ist. Sie schreiben den Verschwörern die Fähigkeit zu, über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinweg die Geschicke eines Landes oder sogar der Welt zu bestimmen“.
Wie abwegig solche Annahmen sind, zeigt Butter unter Einbezug soziologischer, psychologischer und politikwissenschaftlicher Erkenntnisse auf und betont letztlich, wie sehr „konspirationistisches Denken auf einem fehlerhaften Verständnis sozialer Prozesse beruht“. So banal sie klingt, so wichtig erscheint seine Feststellung, dass es ein „wichtiges Charakteristikum von Verschwörungstheorien“ darstellt, dass sie „falsch sind“. Dennoch glauben beachtliche Anteile von Bevölkerungsgruppen daran, wobei Butter insbesondere auf Europa und die USA fokussiert. Keineswegs, so wird dargestellt, findet sich der Glaube an solche Theorien nur etwa bei Rechtsextremistinnen oder Anhä- ngerinnen populistischer Bewegungen und Parteien, wenngleich sich in diesen Zusammenhängen laut Butter deutliche Affinitäten feststellen ließen.
Der Autor identifiziert und unterscheidet drei Arten von Verschwörungstheorien, die er als Ereignis-, System- oder Superverschwörungstheorien erfasst. Allesamt haben gemeinsam, dass sie für Menschen, die an sie glauben, mit einem Gewinn verbunden sind. Sie können sich selbst aufwerten als diejenigen, die ‚das Ganze – im Gegensatz zu allen anderen – durchschauen‘, und sich inszenieren als die „wenige[n] Mutigen, die versuchen aufzuklären und [die] dafür angefeindet werden“.
Verschwörungstheorien wirken komplexitätsreduzierend, stiften Sinn und ermöglichen es, ein positives und weitgehend widerspruchsfreies Selbstbild zu konstruieren. Ebendies mache es laut Butter auch so schwer, Reflexionsprozesse bei Menschen anzustoßen, die Verschwörungstheorien anhängen – Kritik oder ein Hinterfragen werde als Angriff auf das eigene Selbstbild gewertet, was Schließungs- und Abwehrprozesse begünstige sowie Distanzierungsprozessen im Wege stehe. Daher plädiert Butter dafür, dass „Aufklärung […] bei denjenigen ansetzen [sollte], die den Erklärungsangeboten von Verschwörungstheorien schon begegnet, aber davon noch nicht überzeugt sind“.
Zwar ermöglicht das Buch auch für Praktiker*innen der Bildungsarbeit eine sehr gewinnbringende Orientierung in diesem komplexen Themenfeld, aber was das ‚Wie?‘ der ‚Aufklärung‘ betrifft, bleiben die Antworten des Autors leider recht übersichtlich, wenn in allgemeiner Weise zum Beispiel auf ‚Medienkompetenz‘ eingegangen wird. Der Schwerpunkt des Buches liegt jedoch schlichtweg nicht im Bereich der Bildungsarbeit. Insofern schmälert diese Kritik keineswegs seine besondere Bedeutung, die ihm zweifelsfrei zukommt. (Stefan E. Hößl)
Michael Butter • “Nichts ist, wie es scheint.” Über Verschwörungstheorien • Suhrkamp Verlag, Berlin 2018 • 271 Seiten, 18 Euro • ISBN: 978-3-518-07360-5