Das Rentenpaket II wird derzeit im Bundestag beraten. Es soll bundesweit das gesetzliche Rentenniveau dauerhaft stabil halten und gleichzeitig neue Elemente wie das staatliche Generationenkapital einführen. Für viele Menschen in Wermelskirchen stellt sich nun die Frage, ob diese Reform ihre Situation verbessern oder verschlechtern wird. Die Auswirkungen sind dabei je nach persönlicher Lebensphase, Lebensalter und lokaler wirtschaftlicher Lage durchaus unterschiedlich.
Ein stabileres Rentenniveau – kurzfristig ein Vorteil für neue Rentnerinnen und Rentner
Das Herzstück des Rentenpakets ist die Sicherung des Rentenniveaus von 48 Prozent. Das bedeutet für alle Bürgerinnen und Bürger, die in den kommenden Jahren in Rente gehen, eine deutlich verlässlichere Planung und eine Absicherung vor möglichen Absinkbewegungen. Ergänzend dazu verbessert die Reform die Anrechnung von Kindererziehungszeiten, was vor allem vielen Frauen in Wermelskirchen zugutekommt. Wer also in naher Zukunft den Rentenantrag stellt, kann aus heutiger Sicht eher positiv auf die Reform blicken, denn die garantierte Haltelinie und die erweiterten Ansprüche sorgen für ein stabileres, vorhersehbares Renteneinkommen.
Aber bedeutet die 48-Prozent-Regel denn auch, dass zukünftige Rentnerinnen und Rentner dann auch wirklich 48% von ihrem letzten Einkommen an Rente erhalten?
Die Antwort lautet kurz und bündig: NEIN!
Warum die 48-Prozent-Regel nicht bedeutet, dass man 48 % seines Nettoeinkommens als Rente bekommt
Es klingt zunächst einfach, ist aber leider ein weit verbreitetes Missverständnis: Die Zahl von 48 Prozent bedeutet nicht, dass zukünftige Rentnerinnen und Rentner etwa 48 Prozent ihres eigenen früheren Nettoeinkommens erhalten werden. Diese Zahl beschreibt nämlich nicht die persönliche Rente, sondern einen Vergleichswert für das Rentensystem insgesamt.
Das Rentenniveau von 48 Prozent bezieht sich ausschließlich auf eine sogenannte Standardrente. Eine Standardrente ist ein rein theoretisches Beispiel und beschreibt eine Person, die 45 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet hat und in jedem einzelnen dieser Jahre genau so viel verdient hat wie der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland. Dieser Durchschnittslohn ist ein statistischer Wert, der aus allen Einkommen berechnet wird und damit weder einem besonders hohen noch einem besonders niedrigen Gehalt entspricht. Er ist schlicht der Mittelwert aller sozialversicherungspflichtigen Einkommen.
Nur für diese Modellperson, die exakt 45 Jahre gearbeitet hat und dabei immer ungefähr das „mittlere deutsche Gehalt“ verdient hat, ergibt die spätere Rente etwa 48 Prozent des aktuellen durchschnittlichen Nettoeinkommens aller Beschäftigten. Dies ist eine Kennzahl, die das Rentensystem als Ganzes beschreibt. Sie sagt aber nicht aus, was eine einzelne Person tatsächlich erhält.
Die tatsächliche Rente jedes Menschen hängt von der individuellen Lebens- und Arbeitsbiografie ab und weicht daher fast immer von diesem theoretischen Modell ab. Daher ist der Wert von 48 Prozent eine Systemgröße und kein verlässlicher Maßstab für die persönliche Rente.
Die langfristige Finanzierung – eine Belastung für heutige Erwerbstätige
Während die kurzfristigen Effekte für baldige Rentnerinnen und Rentner überwiegend positiv sind, stellt sich die Situation für die heute berufstätigen Menschen anders dar. Die Finanzierung der Reform basiert im Wesentlichen auf einem deutlichen Anstieg der Rentenbeiträge in den kommenden Jahren. Schätzungen zufolge kann dieser Beitragssatz bis in die 2030er Jahre auf über 22 Prozent steigen. Dieser Anstieg bedeutet für viele Beschäftigte in Wermelskirchen spürbare Nettoeinbußen, da sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber höhere Abgaben leisten müssen. Gleichzeitig setzt das Rentenpaket auf die Erträge des geplanten Generationenkapitals. Dass dieses Kapital aus staatlichen Darlehen aufgebaut wird und erst in vielen Jahren nennenswerte Erträge liefern kann, birgt ein erhebliches Risiko. Wenn die Kapitalmärkte schwächer laufen oder die erwarteten Renditen ausbleiben, könnten zukünftige Generationen stärker belastet werden, als es heute absehbar ist.
Lokale demografische Besonderheiten – Wermelskirchen altert weiter
Wermelskirchen selbst steht, wie viele Städte im Bergischen Land, vor einer deutlichen demografischen Verschiebung. Die Bevölkerung ist älter als der Landesdurchschnitt, und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Zahl der älteren Menschen kontinuierlich zunimmt. Das bedeutet für unsere Stadt, dass der Anteil derjenigen, die auf die Leistungen der Rentenversicherung angewiesen sind, steigen wird. Gleichzeitig nimmt die Zahl junger Beitragszahler weniger stark zu. Unter diesen Bedingungen wirken bundesweite Rentenreformen lokal besonders intensiv, da die soziale und wirtschaftliche Balance zwischen Alt und Jung zunehmend herausgefordert wird.
Belastungen für die lokale Wirtschaft – besonders für kleine und mittlere Unternehmen
Ein weiterer zentraler Aspekt betrifft die Unternehmen vor Ort. Wermelskirchen ist wirtschaftlich geprägt von vielen kleinen und mittleren Betrieben. Diese Unternehmen arbeiten oft mit engen Margen und sind empfindlich gegenüber Kostensteigerungen. Wenn die Rentenbeiträge in den kommenden Jahren ansteigen, erhöht das automatisch die Arbeitgeberanteile. Für viele lokale Betriebe stellt das eine finanzielle Zusatzbelastung dar, die sich auf Einstellungen, Lohnentwicklung oder Investitionen auswirken kann. In einer Stadt, deren Wirtschaft stark vom Mittelstand lebt, können solche Entwicklungen die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen und damit mittelbar auch die langfristige Stabilität der Rentenbasis gefährden.
Was folgt nun daraus?
Vorteile für neue Rentner – Herausforderungen für die Zukunft der Stadt
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rentenpaket II für Bürgerinnen und Bürger, die in den kommenden Jahren in Rente gehen, eher positive Effekte bringt. Die Sicherung des Rentenniveaus und die verbesserte Anrechnung von Erziehungszeiten tragen zu einem stabileren Renteneinkommen bei. Für die heutige Generation der Erwerbstätigen sieht das Bild jedoch anders aus. Sie wird die steigenden Beiträge schultern müssen und trägt damit einen Großteil der Last, während die Wirkung des Generationenkapitals zunächst ungewiss bleibt.
Für Wermelskirchen bedeutet die Reform daher einerseits mehr Sicherheit für viele künftige Rentner, andererseits aber auch neue Herausforderungen für die lokale Wirtschaft und die jüngere Bevölkerung. Gerade in einer Stadt mit älter werdender Bevölkerung und einem mittelstandsgeprägten Arbeitsmarkt wird die Frage der finanziellen Tragfähigkeit und Generationengerechtigkeit in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen.
Ein paar Abgrenzungen zu den unterschiedlichen Begriffen:
| Begriff | Erläuterung |
| Garantierte Haltelinie | Die gesetzliche Grenze verhindert, dass das Rentenniveau unter 48 % sinkt. Im Rentenpaket II wird diese Haltelinie bis mindestens 30. Juni 2040 verankert. |
| Gesetzliches Rentenniveau | Das ist das Verhältnis zwischen Durchschnittsrente und Durchschnittsverdienst. Im Paket ist es dauerhaft bei mindestens 48 % angesetzt – ohne Reform hätte es langfristig auf unter 45 % fallen können. |
| Kindererziehungszeiten | Zeiten, in denen Eltern Kinder betreuen, werden bei der Rente angerechnet. Im Rentenpaket II werden nun drei Jahre Erziehung für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, vollständig anerkannt (bei jeweils einem Elternteil). |
| Beitragssatz Arbeitgeberanteil | Der Rentenbeitrag, den Arbeitgeber zahlen, soll laut Entwurf von heute 18,6 % schrittweise auf 22,3 % steigen. |
| Beitragssatz Arbeitnehmeranteil | Den Arbeitnehmer-Teil dieses Beitrags zahlen Beschäftigte aus ihrem Bruttogehalt. Auch dieser Anteil steigt mit dem Gesamtbeitrag auf 22,3 % (geteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer). |
| Staatliches Generationenkapital | Der Bund legt Darlehen in eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die auf einem Kapitalstock (Ziel: bis zu 200 Mrd. €) aufgebaut werden soll. Ab etwa 2036 sind Ausschüttungen von rund 10 Mrd. €/Jahr geplant, um Beitragssätze zu stabilisieren. |
Quellen:
- Bundesregierung: Kabinett beschließt Rentenpaket 2025 (6. Aug. 2025).
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rentenpaket-2025–2368678? - Bundesgesetzentwurf / Bundestagsmaterial (Details zu Darlehen 12 Mrd. und 3%-Steigerung). https://dserver.bundestag.de/btd/20/118/2011898.pdf?
- BMAS / FAQ Rentenpaket 2025. https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Rentenpaket-2025/rentenpaket-2025.html?
- Bundesrechnungshof — Stellungnahmen / Risiken zur Finanzierung. https://www.bundestag.de/resource/blob/1023508/Stellungnahme-Bundesrechnungshof.pdf?
- Institut der deutschen Wirtschaft (IW) — Analysen zu Finanzierungslücken und Beitragssatzprognosen. https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/jochen-pimpertz-2035-fehlen-34-milliarden-euro.html?
- Stadt Wermelskirchen — Zahlen, Daten, Fakten / Einwohnerzahlen; Kommunalprofil NRW. https://www.wermelskirchen.de/aktuelles-rathaus/stadtinfos/zahlen-daten-fakten?
Bild: Illustriert mit Canva, Klaus Ulinski

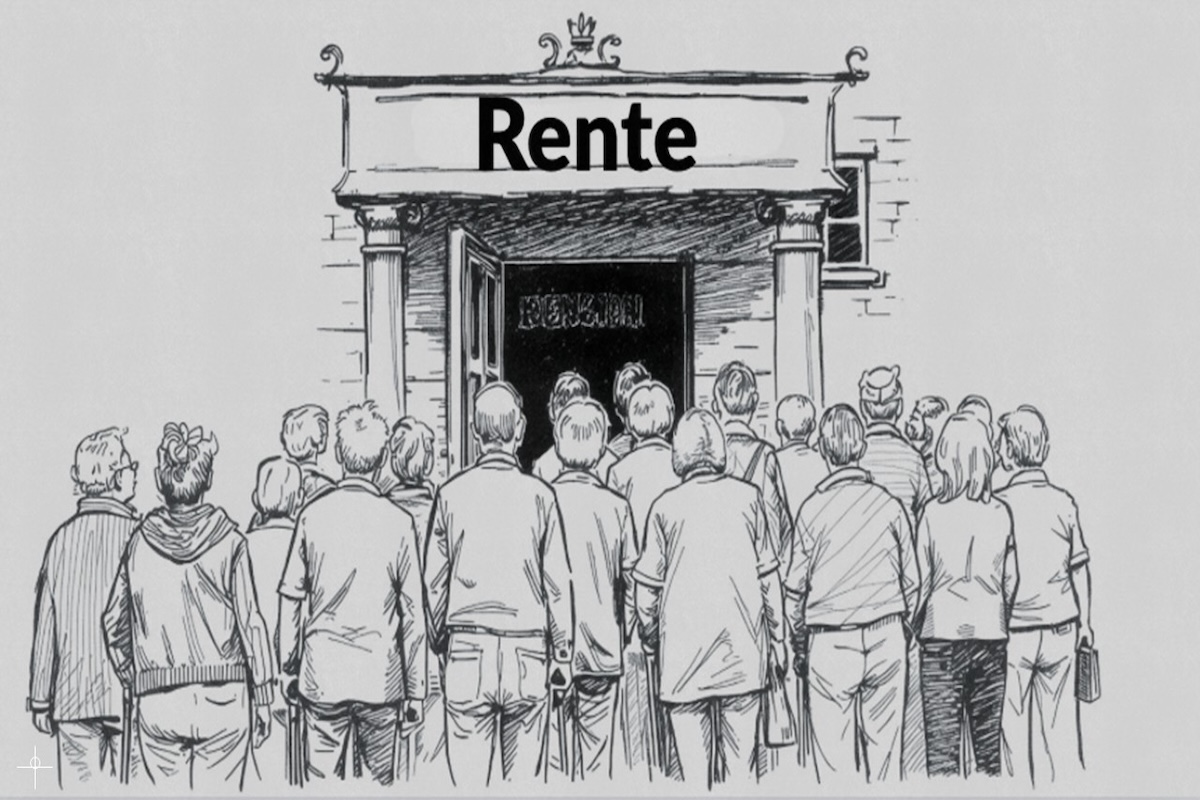
Kommentare
Ein Kommentar zu „Rentenpaket II: Was bedeutet es für künftige Rentnerinnen und Rentner in Wermelskirchen?“
Als Vergleichswert ein Blick auf die gezahlten Beamtenpensionen:
Nach 40 Dienstjahren wird der Höchstsatz von 71,75 % des letzten Grundgehalts erreicht.
Im Januar 2024 betrug die durchschnittliche monatliche Brutto-Pension rund 3.240,00 €. Männer 3.820,00 €, Frauen 3.150,00 € im Monat
Für die staatliche Rente betrugen 2024 (Neurentner) die Durchschnittswerte:
Gesamtdurchschnitt: 1.135,00 Euro (West) bzw. 1.243,00 Euro (Ost) im Monat. (Männer (West): 1.355,00 Euro, Frauen (West): 929 Euro
Durchschnittliche Bruttorente (Stand 2025)
Gesamtdurchschnitt: 1.660,00 Euro
Nach Geschlecht:
Männer: 1.809,00 Euro
Frauen: 1.394,00 Euro
Festzustellen ist zudem, dass das staatliche Rentenniveau in Deutschland sich im europäischen Vergleich lediglich im Mittelfeld befindet.
Pensionen und die staatl. Rente (ab 2040 zu 100%) sind oberhalb der Grundfreibetrages Einkommenssteuerpflichtig. D.h. das Teile der Rente als Steuern an den Staat zurück fließen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass viele RentnerInnen ihr Rente für den täglichen Verbrauch (Konsumtion) einsetzen müssen. Dies stabilisiert die Nachfrage.
Die Unsicherheit bei kapitalgedeckten Renten ist zur Zeit beispielhaft bei der Versorgungskasse der Zahnärzte Berlin beobachtbar: “Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte verliert bis zu eine Milliarde Euro durch Fehlinvestments. Rente von 10.000 Mitgliedern bedroht.” (Telepolis 13.11.2025)
Ein Hinweis noch auf die Stellungnahme des DGB zu den aktuellen Diskussionen (DGB.de): Eine gute Rente für ein gutes Leben
Arbeitnehmer*innen verdienen eine gute Rente. Dieser Grundsatz muss für alle Generationen gelten.
Dort sind einige gute Argumente für die Stärkung der umlagefinanzierte, staatl. Rente zu finden:
Kurz erklärt: Das Thema Rente
Die Rente muss zum Leben reichen, nicht nur zum Überleben. Eine gute Rente erkennt die Lebensleistung der Menschen an.
Deshalb muss das Rentenniveau stabilisiert und perspektivisch wieder angehoben werden.
Das Rentenalter darf nicht weiter angehoben werden – viele schaffen es schon jetzt nicht, bis 65 oder gar bis 67 zu arbeiten.
Zusätzlich brauchen wir eine stärkere betriebliche Altersvorsorge – finanziert von den Arbeitgeber*innen.
Weiters auf der Seite des DGB: https://www.dgb.de/geld/rente/