Autor: Klaus Ulinski
-

Die Kälte ist nicht vorbei – Gedanken vor dem 27. Januar
Ich sitze im ICE, irgendwo zwischen Wermelskirchen und Berlin, Januar 2026. Die Fahrt ist ruhig, fast komfortabel. Deutschland zieht an mir vorbei, Felder, Ortschaften, Industrie – und darüber eine kalte Januarsonne, gedämpft durch dünne Wolken. Man sieht sie kaum, man ahnt sie eher. Sie strahlt keine Wärme aus, eher Distanz. Kälte. Diese Kälte begleitet meine
-

Wenn ein Vorzeigeverein übersehen wird – das „Haus der Vereine“ und der Judoclub Wermelskirchen
Ein großes Versprechen: Das Haus der Vereine Mit dem geplanten „Haus der Vereine“ im Rahmen des Innovationsquartier Rhombus verbindet die Stadt Wermelskirchen große Erwartungen. Es soll ein Ort entstehen, an dem Vereine zusammenkommen, die durch ehrenamtliches Engagement, pädagogische Verantwortung, intensive Jugendarbeit und gesellschaftlichen Mehrwert geprägt sind. Genau an diesem Punkt beginnt jedoch ein kaum nachvollziehbarer
-

Wohnraummangel in NRW – und die Gefahr von Prestigeprojekten in Wermelskirchen
NRW: Der Wohnraummangel ist Realität Der Soziale Wohn-Monitor 2026 des Pestel-Instituts zeigt unmissverständlich, dass der Wohnraummangel in NRW ein strukturelles Problem ist. In Nordrhein-Westfalen fehlen derzeit rund 376.000 Wohnungen. Um diesen Rückstand abzubauen, wären jährlich etwa 94.000 neue Wohnungen erforderlich. Tatsächlich wurden 2024 jedoch nur rund 41.000 Wohnungen fertiggestellt. Der Mangel verschärft sich weiter, vor allem im bezahlbaren Segment. Warum das Wermelskirchen
-

Umfragen ersetzen keine Demokratie – warum die Stärke der AfD kein Freifahrtschein ist
Die beiden Beiträge „Die Politik darf keine Angst vor einem offensiven Umgang mit dieser Partei haben“ haben hier im Forum eine Debatte ausgelöst, die an einem Punkt besonders deutlich geworden ist: Immer wieder wird argumentiert, die AfD sei inzwischen in Umfragen zweitstärkste Kraft und daher eine demokratisch legitimierte Partei, mit der man sich arrangieren müsse.
-

Zukunft beginnt nicht morgen – sie beginnt bei uns
Die Versuchung ist groß, Zukunft an Bedingungen zu knüpfen. Viele sagen: Erst wenn die Lage besser ist, können wir wieder nach vorne denken. Wenn in der Ukraine die Waffen schweigen, wenn wirtschaftliche Sicherheit zurückkehrt, wenn Preise sinken, wenn politische Entscheidungen gefallen sind. Doch genau dieser Gedanke ist ein Irrglaube. Zukunft entsteht nicht aus einer guten
-

Die Weihnachtsbotschaft als Zumutung – in einer Welt voller Widersprüche
In einem wundervollen, stimmungsreichen Heiligabend-Gottesdienst lud Pfarrer Manfred Jetter mit seiner Outdoor-Predigt zum Heiligabend 2025 dazu ein, Weihnachten nicht als idyllische Kulisse, sondern als zutiefst gegenwärtige Erfahrung zu verstehen. Im Spannungsfeld von Dunkelheit und Licht, Kälte und Wärme, Angst und Zuversicht entfaltete die Predigt die Weihnachtsbotschaft als Zumutung – und zugleich als Hoffnung. Sie spricht
-
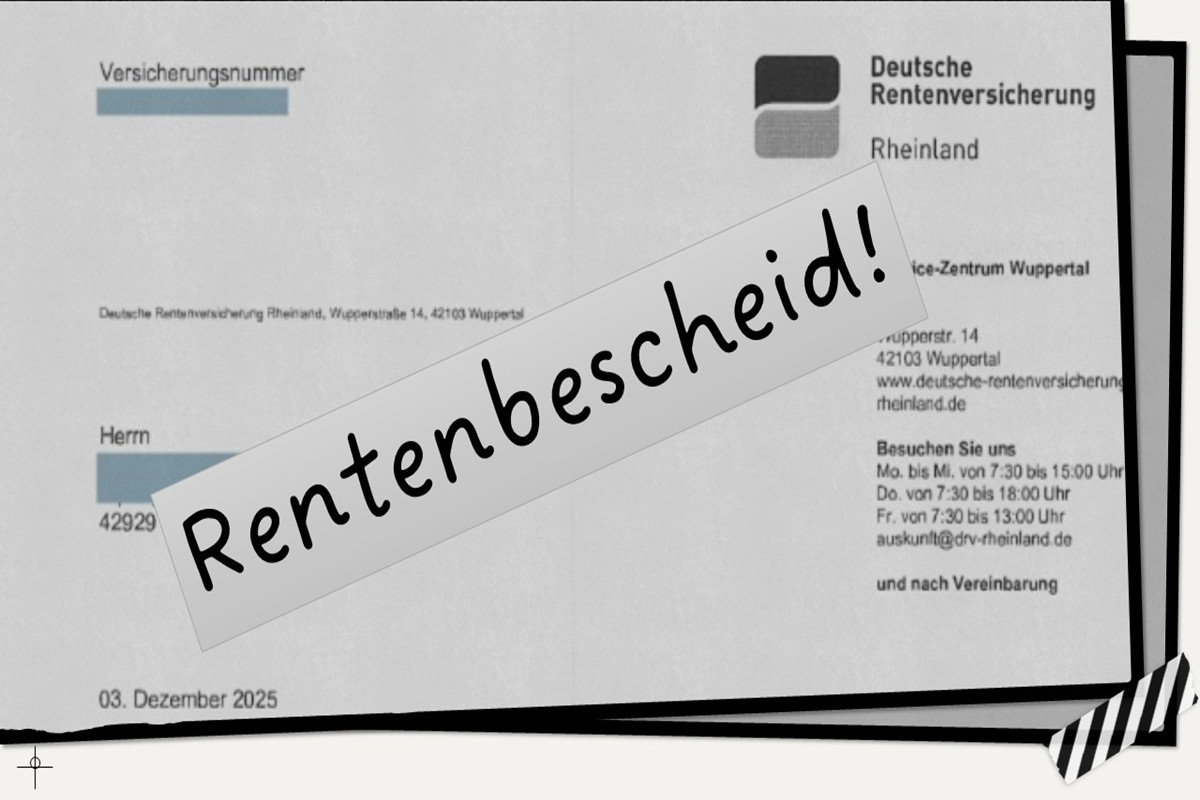
Heute lag Post im Briefkasten. Von der Rentenversicherung.
So ein ganz normaler Umschlag. Weiß. Unaufgeregt. Nichts, was ahnen lässt, dass darin ein Einschnitt steckt. Und dann lese ich es: Ihrem Antrag auf Rente wird stattgegeben. Amtlich. Per Bescheid. Festgestellt durch eine Behörde. Kein „Glückwunsch“. Kein Innehalten. Keine Würdigung. Nur Fakten. Zahlen. Paragraphen. Kühl formuliertes Amtsdeutsch. Und trotzdem – oder gerade deshalb – trifft
-

Eine Frage der Gerechtigkeit
Der Vorschlag des Kämmerers, die Grundsteuer B ab 2026 um 27 Prozent zu erhöhen, markiert einen Punkt, an dem die finanzielle Realität der Stadt Wermelskirchen nicht länger verdrängt werden kann. Das Eigenkapital schrumpft, die Ausgaben steigen, und ohne zusätzliche Einnahmen wird die Stadt ihre gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Doch so zwingend diese Situation
-

Eine Frage der Höflichkeit
Mir fällt in letzter Zeit immer wieder etwas auf: Es gibt Menschen, die mir mürrisch begegnen. Andere nehmen mich gar nicht wahr, gehen an mir vorbei, als sei ich Luft. Und dann gibt es die, die freundlich sind, aufmerksam, zuvorkommend – die, bei denen man sofort spürt: Die meinen es gut. Dabei ist Höflichkeit keineswegs
-

Verrat!
…an eigenen Werten – und warum er bis nach Wermelskirchen reicht Ein Essay von Klaus Ulinski für das Forum Wermelskirchen Einleitung: Warum Wermelskirchen hinschauen muss Weltpolitik wirkt oft weit entfernt. Entscheidungen in Washington, Moskau oder Brüssel scheinen auf den ersten Blick nur selten etwas mit unserem Alltag im Bergischen Land zu tun zu haben. Doch
-

Ein Licht geht um die Welt
Weltgedenktag für verstorbene Kinder – Sonntag, 14. Dezember Herzliche Einladung zum Gedenkgottesdienst am 14. Dezember und 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Dabringhausen. Ich schreibe diesen – sehr persönlichen – Beitrag nicht als Organisator, nicht als Sprecher eines Vereins. Ich schreibe ihn als Großvater. Unser Enkelkind war gerade einmal zwei Monate alt, als es
-
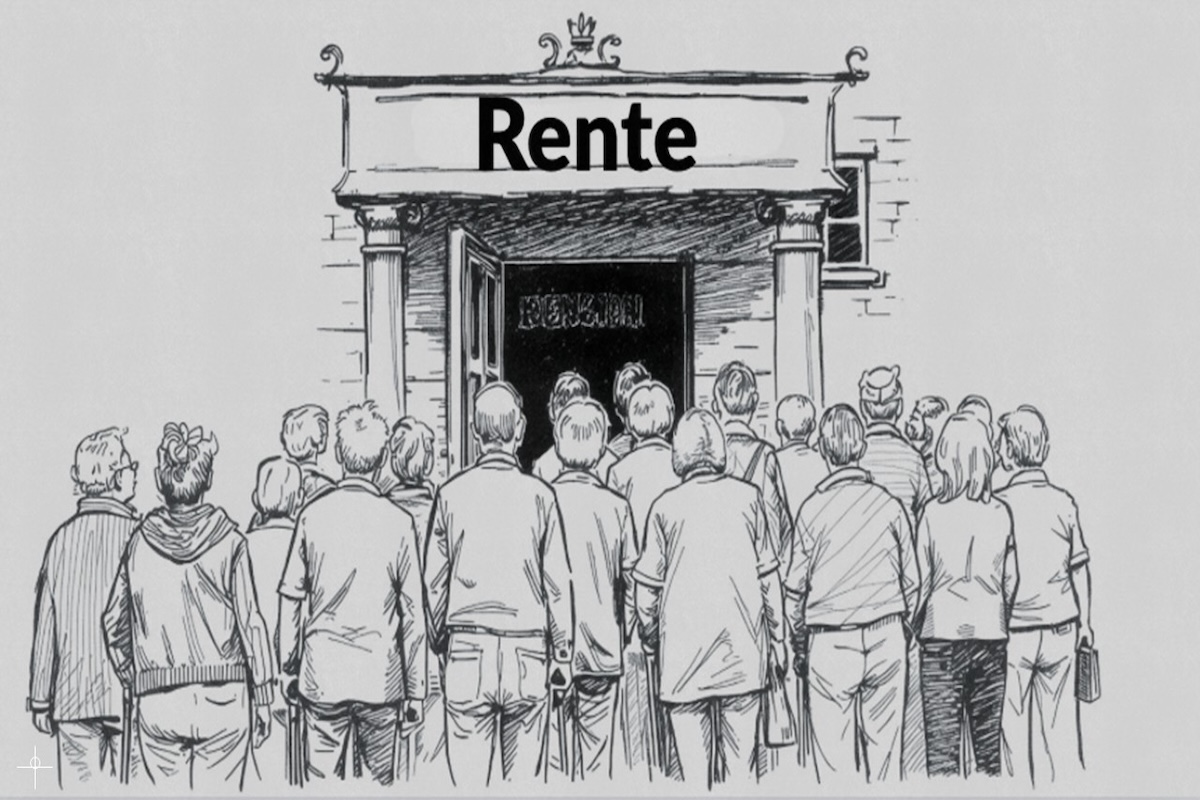
Rentenpaket II: Was bedeutet es für künftige Rentnerinnen und Rentner in Wermelskirchen?
Das Rentenpaket II wird derzeit im Bundestag beraten. Es soll bundesweit das gesetzliche Rentenniveau dauerhaft stabil halten und gleichzeitig neue Elemente wie das staatliche Generationenkapital einführen. Für viele Menschen in Wermelskirchen stellt sich nun die Frage, ob diese Reform ihre Situation verbessern oder verschlechtern wird. Die Auswirkungen sind dabei je nach persönlicher Lebensphase, Lebensalter und
